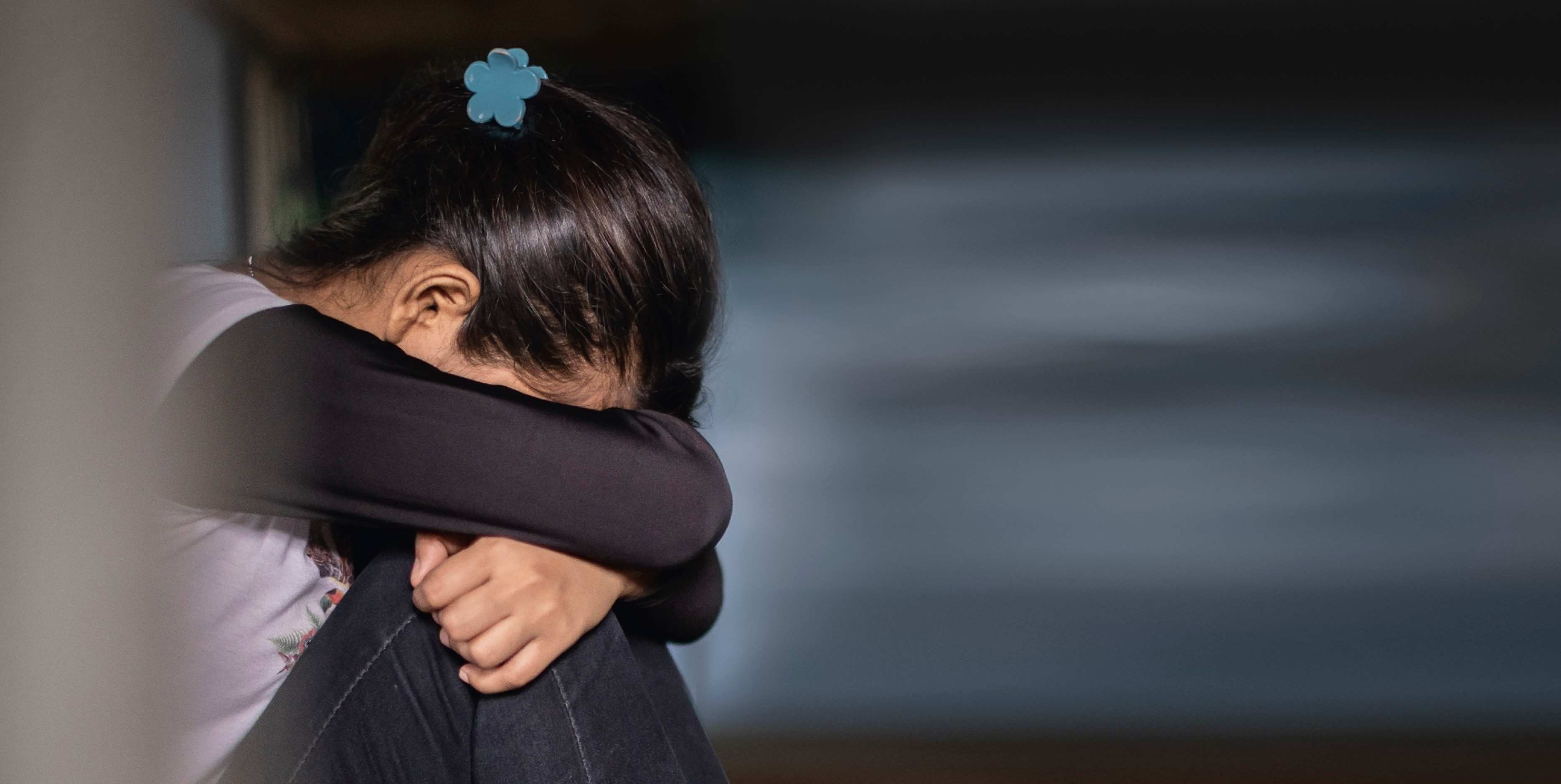Zum ersten Mal selbstbewusst Nein sagen


Welche Formen von Gewalt erleben Kinder? Und wer ist besonders gefährdet?
Adriane Branco Penna: Brasilien steht vor vielen Herausforderungen, dazu gehört auch die Bekämpfung der Gewalt, für die sich Serpaf engagiert. Kinder erleben jede Form von Gewalt: psychische und physische, geschlechtsspezifische und sexualisierte Gewalt, Rassismus, Mobbing. Überall sind Kinder gefährdet, aber wir haben beobachtet, dass Familien im ländlichen Raum noch schlechter informiert und schlechter vernetzt sind als in der Stadt. Auch die Mitarbeitenden in den Institutionen sind dort oft weniger gut ausgebilde und vernetzt. Darum bleiben Gewalterfahrungen auf dem Land eher unerkannt.
Und noch etwas: Das Phänomen der Gewalt in Brasilien ist sehr komplex. Gewalt wird von Generation zu Generation weitergetragen und normalisiert. Wir müssen an die Wurzeln des Problems.
Und wie machen Sie das? Wie können Sie mehr Aufmerksamkeit für das Thema erregen?
Wir arbeiten auf drei Ebenen:
Auf der Makroebene adressieren wir die Politik, zum Beispiel engagieren wir uns in sogenannten Stadträten, um die Rechte von Kindern und der Frauen zu stärken und Maßnahmen für einen besseren Schutz vor Gewalt durchzusetzen. Das Bewusstsein hat sich hier auch schon verändert, aber das ist ein langwieriger Prozess.
Auf der Mesoebene arbeiten wir an der Professionalisierung der Akteure des sogenannten "Systems zur Gewährleistung der Rechte von Kindern und Jugendlichen". Das sind diejenigen, die direkt oder indirekt mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, zum Beispiel in Bildungs-, Gesundheits- und sozialen Einrichtungen sowie Jugendamt, Polizei oder an Gerichten. Wir sensibilisieren sie für das Thema und bieten ihnen Weiterbildungen, damit sie betroffene Kinder psychosozial besser unterstützen können. Auch schulen wir Fachkräfte unterschiedlicher Instanzen darin, sich für das Fallmanagement zu vernetzen und abzustimmen, um von Gewalt betroffene Kinder und Jugendliche nicht zu retraumatisieren, indem sie ihre Erfahrungen mehrmals schildern müssen.
Auf der Mikroebene erreichen wir direkt die Familien und Kinder. Wir gehen zum Beispiel in Frauengruppen und sprechen mit den Müttern, Großmüttern und anderen Bezugspersonen über ihre eigenen Erfahrungen mit Gewalt. Vieles haben sie verdrängt, und unbewusst lassen sie dann auch Gewalt bei ihren eigenen Kindern zu oder üben sie selbst aus. Wir machen ihnen deutlich, wie sehr sich ihr eigenes Leben und das ihrer Kinder verbessert, wenn sie Gewalt nicht zulassen. Das braucht viel Zeit, bis sie dieses Verständnis verinnerlichen, aber wir sehen auch, dass es sich lohnt, weil es wirklich zu Veränderungen und einem anderen Verhalten in den Familien führt.
Wie unterstützen Sie Kinder, insbesondere Kinder, die selbst Gewalterfahrungen gemacht haben?
Wir suchen nach Wegen; damit sich die Kinder und Jugendlichen erst einmal sicher bei uns fühlen. Wir bieten Workshops und Projekte im Bereich Tanz, Theater, Zirkus, Fotografie oder Medien an. Darüber arbeiten wir mit ihnen zu Themen und Erfahrungen, die sie in ihrem Leben belasten, zum Beispiel zu Mobbing, Rassismus, sexualisierter Gewalt und sozialen Problemen. Wir geben ihnen Rückhalt und empowern sie, damit sie in der Lage sind, sich selbst zu schützen, Grenzen aufzuzeigen und sich auf politischer Ebene für ihre Rechte einzusetzen. Neulich erzählte mir ein Mädchen, das sie zum ersten Mal selbstbewusst Nein gesagt hat. Dabei ist mir das Herz aufgegangen. In solchen Momenten spüre ich, wie wichtig unsere Arbeit ist.