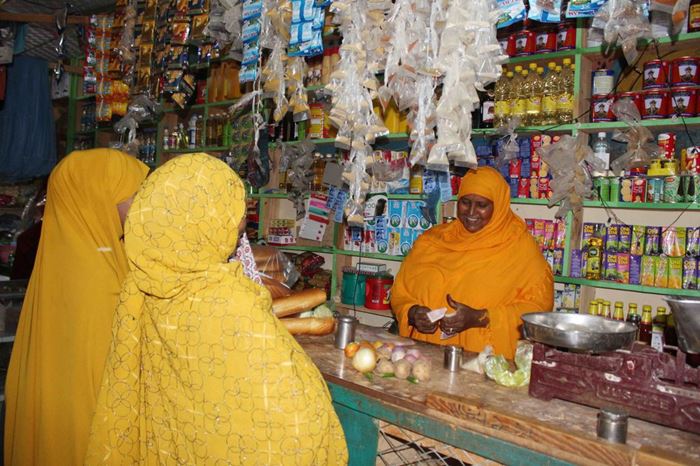Somalia: Der Kampf gegen die Genitalverstümmelung
In dem ostafrikanischen Land ist die weibliche Genitalverstümmelung tief in der Gesellschaft verankert. Mehr als 90 Prozent der Frauen haben das grausame Ritual durchlitten, das vielen immer noch als erhaltenswerte Tradition gilt. Unvorstellbare Schmerzen und gesundheitliche Probleme begleiten viele dieser Frauen ein Leben lang.
Mehr anzeigen
Ein Bewusstseinswandel setzt nur langsam ein: Die Regierung hat lediglich die schlimmste Form der Genitalverstümmelung verboten. Wir setzen uns mit unseren Projekten gegen jede Form der Genitalverstümmelung ein. Und arbeiten daran, dass die Menschen erkennen: Genitalverstümmelung ist eine massive Menschenrechtsverletzung, sie schadet der Gesundheit und es gibt keinerlei religiöse Grundlage für diese Praktik.
Unsere Projekte haben häufig eine zweite wichtige Komponente: Maßnahmen gegen die Dürre. Die Instandsetzung von Zisternen sichert den Menschen sauberes Trinkwasser. Und Schulungen zeigen Bauern, wie sie mit wassersparenden Anbaumethoden möglichst gute Ernten erzielen können.
Unsere Projekte haben häufig eine zweite wichtige Komponente: Maßnahmen gegen die Dürre. Die Instandsetzung von Zisternen sichert den Menschen sauberes Trinkwasser. Und Schulungen zeigen Bauern, wie sie mit wassersparenden Anbaumethoden möglichst gute Ernten erzielen können.
Mehr anzeigen
Unser Einsatz in Somaliland in Zahlen
1980
Beginn der Arbeit in Somaliland
8
Projekte
86 918
Kinder in den Projekten
Eindrücke aus unseren Projekten in Somalia
Seriös und effizient


Alles, was wir tun, ist darauf ausgerichtet, dass Ihre Spende sicher und direkt bei den Kindern ankommt. Dass wir unsere Aufgabe sehr gut erfüllen, bestätigt uns das unabhängige DZI-Spendensiegel jährlich – seit 1992.
Mehr anzeigen
Wir sind gerne für Sie da

Helfen Sie, Mädchen in Somalia zu schützen
Im Folgenden können Sie eine einmalige Spende für unsere weltweite Projektarbeit tätigen. Mit Ihrer Spende helfen Sie dabei, Familien über das brutale Ritual der Beschneidung aufzuklären und Mädchen vor dieser Tradition zu schützen.
- oder -
Mein Wunschbeitrag