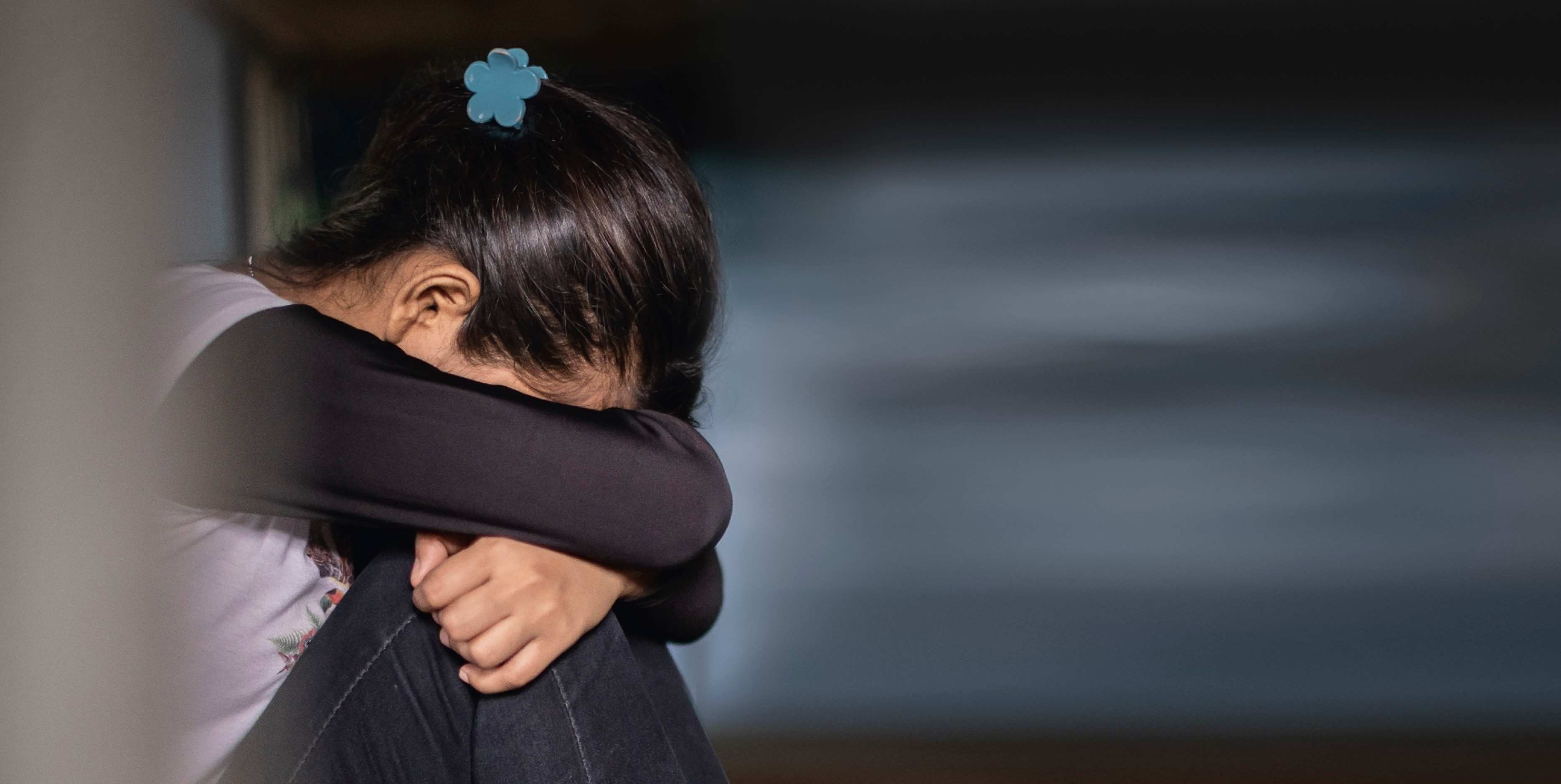Brasilien: "Die Kindergeschichten gehen unter die Haut"
Text: Angelika Böhling Fotos: Florian Kopp
Während der Olympischen Spiele 2016 in Brasilien nutzte Kindernothilfe-Botschafterin Lena Gercke ihren Aufenthalt, um ein Projekt der Kindernothilfe in São Paulo zu besuchen.
Lena Gercke im UNAS-Zentrum
Hier im Zentrum der Kindernothilfe-Partnerorganisation UNAS, mitten im größten Armenviertel São Paulos, finden täglich fast 120 Kinder das, was sie zu Hause nicht haben: einen Platz, an dem sie ungestört spielen, lachen und laut sein dürfen. Einen Ort, an dem es keine Gewalt gibt, dafür aber Menschen, denen die Mädchen und Jungen ihr Herz ausschütten können, die ihnen helfen und die ihnen zeigen, wie sie sich schützen können.


In der Puppenecke hockt die elfjährige Leticia an ihrem Lieblingsplatz und lächelt das Model an. Zöpfe flechten, Haare glätten – die beiden verstehen sich sofort und kommen ins Gespräch. Sie wohne mit ihrer Mutter und drei Geschwistern ganz in der Nähe in einer kleinen Wohnung, erzählt Leticia der Besucherin aus Deutschland. Sie gehe gerne in die Schule, und wenn sie groß sei, möchte sie als Frisörin arbeiten, strahlt die Kleine und rückt mit einem gekonnten Handgriff die große Schleife auf ihrem Kopf zurecht. Den Vater habe sie schon lange nicht mehr gesehen, aber wenn er vorbeikäme, gehe es meist sehr laut zu. „Nein“, sagt sie dann leise „ohne meinen Vater ist es besser zu Hause.“
„Zwischen 70 und 80 Prozent der Kinder in den Armenvierteln der Megastadt São Paulo wachsen ohne Vater auf“, erklärt später Christiane Rezende, eine der Kindernothilfe-Koordinatorinnen in Brasilien. Die Frauen heiraten häufig, um den Schlägen oder sexuellen Übergriffen im eigenen Elternhaus zu entkommen. Doch der Mann, auf den sie treffen, hat nicht selten eine ähnliche Kindheit erlebt. „Gewalt zieht Gewalt nach sich. Wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass Kinder, die Gewalt erfahren haben, das als normal ansehen, akzeptieren und sie auch in Zukunft gegen die eigenen Kinder anwenden.“ Gemeinsam mit Kindern, Eltern und Lehrern wollen die Mitarbeiter von UNAS in sechs Kinderzentren in São Paulo aus dem Kreislauf der Gewalt ausbrechen und Wege aufzeigen, wie ein friedliches Miteinander möglich ist.


Über 252.000 Fälle von Gewalt gegen Kinder und Jugendliche in einem Jahr
Wie groß Ausmaß und Bandbreite der Gewaltanwendungen gegen Kinder und Jugendliche in Brasilien sind, zeigt die Auswertung der Daten eines landesweit geschalteten Hilfe-Telefons aus dem Jahr 2013: Über 252.000 Fälle von Gewalt gegen Kinder und Jugendliche wurden in der Notrufzentrale registriert. Die meisten Anrufe gingen wegen Vernachlässigung und psychischer Gewalt ein. Mehr als 40 Prozent der Kinder und Jugendlichen klagten über Schläge und Misshandlungen im eigenen Elternhaus, und mehr als ein Viertel der Anrufer, also fast 14.000 Mädchen und Jungen, zeigten sexuellen Missbrauch an. Doch warum ist die Gewalt in Brasilien so allgegenwärtig?
Eine mögliche Antwort: Bis Ende der Achtzigerjahre beherrschte eine brutale Militärdiktatur das Land. Ihre Macht sicherte sich die Regierung über viele Jahre durch grausame Folter und das systematische Ausschalten von Andersdenkenden. Erste Demokratisierungsprozesse – und damit die Achtung der Kinder- und Menschenrechte – entwickelten sich erst mit Einführung der Verfassung von 1988. Gleichzeitig mit den demokratischen Veränderungen in der Politik nahm aber die Gewaltbereitschaft in der Gesellschaft zu. Der Grund dafür: Vorhaben, wie etwa soziale Ausgaben zu erhöhen oder die Urbevölkerung zu schützen, blieben aus, und die Kluft zwischen Arm und Reich wurde größer – selbst in den Jahren des wirtschaftlichen Wachstums.


Theaterspielen hilft, die eigenen Erlebnisse zu verarbeiten


20 Quadratmeter für sechs Personen
„Ich bin froh“, sagt die 34-jährige Mutter, „dass meine Söhne im Zentrum gut versorgt sind und dort auch essen können. So habe ich eine Sorge weniger.“ Und wenn Probleme in der Schule auftauchen, springen die Mitarbeiter von UNAS auch ein und helfen weiter. „Es ist nicht leicht, sich in das Leben der Kinder hineinzuversetzen“, sagt Lena Gercke später nachdenklich. „Ein Besuch wie dieser hilft mir zu verstehen, dass die Kinder hier nicht nur Opfer, sondern auch ganz starke Persönlichkeiten sind.“
Hintergrund:
Rund 11,5 Mio. Menschen leben in Brasiliens städtischen Armenvierteln, den Favelas. Alleine im Südosten Brasiliens wohnen fast zehn Prozent aller Kinder und Jugendlichen in Favelas. In São Paulo unterstützt die Kindernothilfe zusammen mit der lokalen Partnerorganisation UNAS 400 Mädchen und Jungen zwischen sechs und 16 Jahren in drei Kinder- und Jugendzentren.
Machen auch Sie sich stark gegen Kinderarbeit
Über die Autorin